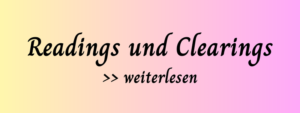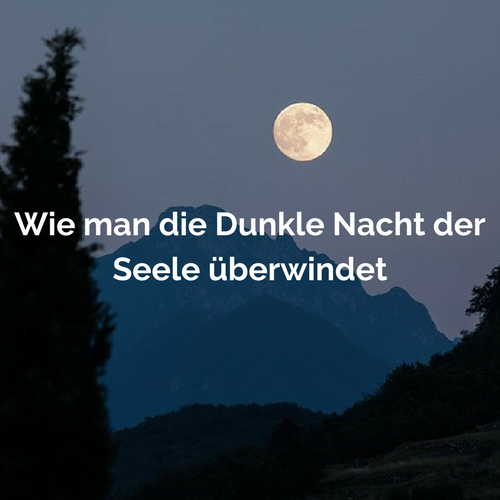Eine interessierte Leserin bat mich, meinen Blick auf einen Psychose-Bericht zu werfen, der auf Sein.de und in Buchform erschienen ist. Darin schildert Vera Maria, die auch medial präsent ist, ihre Psychose. Im Folgenden ist zunächst eine Zusammenfassung des Originaltextes von Vera Maria zu sehen. Danach habe ich die Passagen, die mir besonders relevant erscheinen, im Original herausgegriffen und analysiert.
Die unheimliche Magie der Psychose
Die Frage, ob Psychose bloß Krankheit oder auch Bewusstseinserweiterung ist, durchzieht den gesamten Erfahrungsbericht. Vera Maria beschreibt ihre Ambivalenz: Ärzte sehen eine Diagnose, sie selbst erlebt darin Wahrheiten, Einsichten und eine spirituelle Dimension.
Die medizinische Deutung
Offiziell lautet ihre Diagnose „schizoaffektive Störung“ – eine Mischung aus Depression, Manie und Psychose. Medizinisch bedeutet dies Realitätsverlust, Halluzinationen und suizidale Gefahren. Klinikaufenthalte, Isolierzimmer und Kontrollverlust bilden die dunkle Seite dieser Realität.
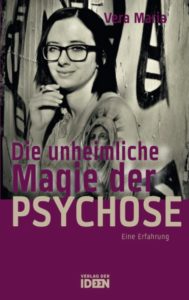 Visionen und Erweiterungen
Visionen und Erweiterungen
In den Psychosen jedoch erfährt sie auch tiefe Erkenntnisse:
- das Erkennen biographischer Ursachen ihrer Ängste,
- symbolische Begegnungen mit „Göttern“, Yin und Yang, Tod,
- Gleichnisse von Klavier und Buddhismus, die das Leben als Harmonie von Gegensätzen deuten.
Diese Erlebnisse empfindet sie als Schatztruhe verborgenen Wissens, das sich nur in Grenzzuständen öffnet.
Ambivalenz und Potenzial
Psychose erweist sich zugleich als spirituelle Reise und als Horror. Zwischen Offenbarung und Überforderung liegt ein schmaler Grat. Vera Maria glaubt: Psychosen bergen ein ungeahntes Potenzial, das noch unzureichend erforscht ist. Vielleicht könne man eines Tages die weiten Bewusstseinsräume erschließen, ohne an der Reizüberflutung zu zerbrechen.
Krankheit oder Erweiterung?
Psychose bleibt ambivalent – Krankheit und Erweiterung zugleich. Für die Medizin ein Defekt, für spirituelle Traditionen ein Tor. Für Vera Maria ist sie beides: zerstörerisch und schöpferisch, gefährlich und erhellend.
Quelle
Der Text im Original kann hier nachgelesen werden.
Der Erfahrungsbericht in Buchform kann hier nachgelesen werden.
***
Erörterung ausgewählter Textpassagen im Original
Text 1: Kommentar
„Es ist Spinnerei zu behaupten die Krankheit Psychose könnte mehr sein, als das, was sie ist, nämlich eine Krankheit. Der Gedanke Psychose könne irgendein Potential enthalten, ist schlichtweg dumm und entspringt wahrscheinlich deinem psychotischen Gedankengut. Also ist es Teil deiner Krankheit. Wenn du wieder normal wirst, wirst du dies einsehen. Auch die religiösen Wahrheiten, die du zu entdecken glaubtest, würden wohl von Theologen so nicht bestätigt werden.“
Erörterung
Abgesehen von der wertenden Tonalität dieser Passage spiegelt sie doch den gängigen Denkstil über Psychose wider – geprägt von „erlaubter“ Spiritualität, psychologischen Normvorstellungen und der Haltung jener, deren Bewusstsein noch keine Erweiterung erfahren hat.
Experiment und Befragung: Trip oder Psychose?
Ich legte 17 Erlebnisberichte von Menschen, die eine Psychose erfahren hatten, einer Gruppe von Personen vor, die regelmäßig Changa, Cannabis oder DMT konsumieren, aber auch Iboga, Salvia, LSD oder Psilocybin kennen. Anders gesagt: Psychose traf hier auf Psychedelik.
Dabei verschwieg ich den Teilnehmern, dass die Texte von diagnostizierten Psychose-Patienten stammten. Ich stellte die Berichte lediglich vor und bat um ihre Eindrücke.
Die Reaktionen waren erhellend: Es wurde diskutiert, ob die beschriebenen Erfahrungen eher durch DMT oder Cannabis hervorgerufen worden seien, ob manche Sequenzen einem psychedelischen Ego-Tod oder Durchbruch ähnelten, und ob möglicherweise auch MDMA eine Rolle gespielt haben könnte. Die Gespräche bewegten sich zwischen unmittelbarer Erfahrung und interpretativer Reflexion.
Alle deuteten die Erlebnisberichte zunächst als Trips. Als ich erklärte, dass es sich um Erfahrungen von Menschen handelt, die unter anderem in psychiatrischen Einrichtungen waren – Berichte von Personen, die keinerlei Substanzen genommen hatten – war der Schock mindestens so groß wie das Mitgefühl. Niemand wollte werdende Götter in psychiatrischen Einrichtungen sehen oder sie als krank stigmatisieren; dies wurde beinahe als „Sünde“ empfunden. Das heilige Gefühl der Psychonautik schien dadurch verletzt. Gleichzeitig wollte aber auch niemand dauerhaft, über Wochen oder Monate, in einem Trip verweilen. Aus dieser Spannung entstand ein tiefes Mitgefühl.
Damit sei festgehalten:
Menschen, die jahrelang psychedelische Erfahrungen haben, betrachten die Erlebnisse von Psychose-Menschen als Trips.
Psychose ist also ein intensiverer und länger andauernder Trip, der ebenso bewusstseinserweiternden Charakter hat, wie jeder gelungene Trip auf Substanzen bewusstseinserweiternden Charakter hat.
Wer definiert spirituelle Erfahrungen?
„Auch die religiösen Wahrheiten, die du zu entdecken glaubtest, würden wohl von Theologen so nicht bestätigt werden.“
Die spirituellen Wahrheiten, die Vera Maria erlebte, bedürfen meines Erachtens keiner äußeren Bestätigung. Osho erklärte sich selbst für erleuchtet, ebenso Eckhart Tolle – niemand von offizieller Seite bestätigte ihre Erleuchtung. Dass weder Osho noch Tolle je psychiatrische Einrichtungen durchlaufen haben, mag manchen die Abgrenzung zwischen psychischer Disposition und spiritueller Erfahrung schwer nachvollziehbar machen. Doch gerade deshalb gilt: Individuelle spirituelle Erfahrungen brauchen kein „Gütesiegel“ von außen. Wer betet, sich Gott nahe fühlt oder innere Wahrheiten erfährt, erfährt ihre Gültigkeit unmittelbar und persönlich. Kein Theologe, keine Psychologie und keine institutionelle Autorität kann diese unmittelbare Erkenntnis ersetzen oder ihre Echtheit bestätigen. Spirituelle Erfahrung ist selbstvalidierend – sie lebt im Erleben desjenigen, der sie erfährt.
Text 2
Plötzlich hatte ich Ideen und Einsichten, die mir im normalen Zustand, also jenseits der Psychose nicht zugänglich waren. Ich hatte das Gefühl, auf ein Wissen, das tief in mir verankert ist, zugreifen zu können, als würde sich mir eine Schatztruhe öffnen, die normalerweise fest verschlossen war. Plötzlich konnte ich darauf zugreifen, konnte die Truhe einen Spalt breit öffnen und völlig neue Erkenntnisse gewinnen. Einige der Erkenntnisse, die sich mir schlagartig offenbarten, schrieb ich in einem langen Brief an mich selber auf.
Plötzlich wusste ich einfach, dass der Grund meiner Angststörung die Wochenbettdepression meiner Mutter war. Mir gelang das Aufstellen eines Krankheitsmodells, mit den Ursachen für meine Angststörung. Ich habe zwar oft mit Psychologen versucht, die Gründe für meine Angststörung zu finden, doch diese Einsichten, die ich mitten in der manisch geprägten Psychose hatte, waren gänzlich neu und ergaben ungemein viel Sinn.
Nie habe ich im Laufe der Therapie, obwohl ich ja von vielen Psychiatern und Psychologen bereits behandelt worden bin, solche logischen und konsistenten Erklärungen gefunden. Für mich ist das ein weiterer Beweis dafür, dass sich das Bewusstsein während einer Psychose weitet und man tief ins Unterbewusstsein eindringen kann, und dort auf sonst verborgenes Wissen zugreifen kann.
Erörterung
Darin offenbart sich für mich der eigentliche Heilimpuls der Bewusstseinserweiterung: das Aufbrechen festgefahrener Deutungsmuster und die Möglichkeit, innere Konflikte in einem neuen Licht zu sehen. Substanzen können diesen Prozess anstoßen – so berichtete Timothy Leary von ihrer befreienden Wirkung, Stanislav Grof entfaltete daraus eine ganze transpersonale Psychologie, und Terence McKenna schilderte, wie sein erstes LSD-Erlebnis den latenten Generationskonflikt mit seinen Eltern in eine unmittelbare Konfrontation verwandelte. Natürlich entsteht dieser Effekt nicht bei jedem und nicht automatisch; Substanzen sind keine Garantie, sondern Werkzeuge, die das Unbewusste beschleunigt auf die Bühne holen. Doch gerade darin liegt ihr Potential: Sie öffnen Räume, die jenseits des Gewohnten liegen, Räume, in denen Heilung, Krise und Einsicht untrennbar verwoben sind. Wer tiefer in diese außergewöhnlichen Erfahrungswelten eintauchen will, findet reiches Material bei Stanislav Grof.
Text 3
Ich weiß nicht, inwieweit ich halluziniert oder Wahrheit und Realität mit Krankheit vermischt habe. Ich bin ein gläubiger Mensch und der festen Überzeugung, dass es Dinge gibt, die man sich nicht mit dem Verstand erklären kann.
Für die Ärzte ist eine Psychose eine Krankheit. Für die Schamanen der indigenen Völker wäre sie vielleicht sogar ein Wunder, das Zugänge zu höheren Wirklichkeiten ermöglicht.
Was ist sie für mich? Ich weiß es immer noch nicht. Aber ich glaube, dass ich Dinge halluziniert habe, die aus meinem Unterbewusstsein projiziert wurden. Während dieser Psychosen habe ich um Zusammenhänge gewusst, die mir normalerweise nicht bekannt sind. Ich hatte Zugang zu einem Wissen, das wahrscheinlich jeder von uns in sich trägt, welches aber im Alltag wie in einer Schatztruhe fest verschlossen bleibt. Diese Schatztruhe öffnet sich nur in erweiterten Geisteszuständen, also durch Krankheit oder durch den Einfluss von Drogen.
Erörterung
Was hier m. E. zu verstehen ist, ist, dass Halluzination mit Einbildung und Irrealität und Krankheit gleichgesetzt wird. Das Deutungsschema ist negativ. Auch der Begriff Psychose ist negativ.
Terence McKenna nannte eine seiner Publikationen Wahre Halluzinationen. Damit wird der Halluzination Wahrheitsgehalt zugebilligt. Die Aussprüche „Du halluzinierst doch!“ markieren das Verrücktsein, weil andere Menschen diese Wahrheit nicht sehen und erfassen können.
Der Denkstil bestimmt das Ergebnis
So zersplittert die spirituelle Szene in sich auch sein mag – ähnlich wie die esoterische oder psychologische –, so herrscht doch meist Einigkeit, sobald es um die Pathologisierungen der Psychologie geht: Psychose, Wahn und Schizophrenie gelten als Krankheit. Spirituelles wird darin nicht gesehen.
Meiner Ansicht nach ist es heikel, wenn das Denken stets in „Entweder-oder“-Kategorien verläuft, gleich bei welcher Fragestellung. Weisheit liegt vielmehr darin, die Perspektive des „Sowohl-als-auch“ einzunehmen.
Man kann demnach die Dunkle Nacht der Seele oder ein Kundalini-Erwachen entweder als eine Mikro-Psychose betrachten, die in ihrem bewusstseinserweiternden Aspekt nicht so fordernd ist, dass sich das Ich verliert – auch wenn auch hier ein Ego-Tod geschehen kann –, oder man betrachtet sie als High-Level-Spiritualität, die nur gewisse Menschen erreichen. Der Denkstil ist im ersten Fall einschließend, im zweiten Fall ausschließend, im ersten Fall aufgrund der Pathologisierung abwertend, im zweiten Fall aufwertend.
Neutraler Begriff vs. Psychose
Bleibt man beim einschließenden Denkstil, so gibt es – als vorläufiges Modell – auf der Basis transzendentale Erfahrungen, mit denen ein Mensch umgehen kann. Diese Erfahrungen reichen von Energie-Empfindungen, außerkörperlichen Erfahrungen, Visionen, Mystik, paranormalen Fähigkeiten bis hin zu interdimensionalen Gesprächen mit Außerirdischen und Elfen – wenn man so will. Auf der Pyramiden-Spitze steht allerdings die „Psychose“ in allen Aspekten, auch dissoziative Zustände, die ich fortan Bewusstseinsverschiebung nennen möchte. Psychose ist noch einmal „mehr“. Sie ist keine Erschütterung des Ichs, kein bloßer Energie-Input, sondern so überwältigend, so viel, dass sie nicht integriert werden kann.
Psychologiekritik und die Negativ-Perspektive
Über die Negativ-Konnotierung der Psychologie entsteht im Fall Vera Marias bei Abklingen der Psychose Unsicherheit. Sie hat erlebt, was sie erlebt hat. Nicht alles daran war schlecht, vieles daran war wertvoll. Trotzdem klebt das Psychose-Etikett darauf und sie fragt sich, ob das alles als krank zu werten war. Die Psychologie nötigt diese Menschen, sich als krank zu betrachten. Alleine das ist m. E. nicht nur in humanistischer Hinsicht bedenklich, sondern unmenschlich – für die betreffende Person in jedem Fall selbstwertschädigend.
Psychologie als Ersatzreligion
Ich wünsche Vera Maria, möge sie die innere Stärke finden, sich von den Negativ-Programmierungen der Psychologie und ihrer Terminologie zu befreien. Sie ist nicht krank – sie lebt in einer Ära, in der die Psychologie an die Stelle der Religion getreten ist. Der Sozialwissenschaftler Albert Krölls formuliert es pointiert: Die Psychologie sei das moderne „Opium des Volkes“, sie stärke das bürgerliche Konkurrenzdenken, indem sie Scheitern als Anstoß zur persönlichen Entwicklung umdeutet und zur Anpassung animiert.
Er kritisiert den deterministischen Erklärungsansatz, der menschliches Verhalten als durch Triebe, Verhaltensmuster oder Umwelteinflüsse gesteuert darstellt – ein Bild, das die Person zum Konfliktmanager ihrer inneren Impulse degradiert. Statt der Diagnose empfahl Krölls eine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft selbst – denn dort liegt die Ursache psychologischer Deutungsmuster.
Psychologiekritik in Filmen
Filme von M. Night Shyamalan wie „The Sixth Sense“, „Split“ und „Unbreakable“ lassen sich als künstlerische Psychologiekritik verstehen: Hier sind psychische Dispositionen nicht Defizite, sondern verborgene Gaben. Superhelden stehen paradigmatisch für Individuen, die sich ihrer Fähigkeiten und Andersartigkeit erst bewusst werden. Das gesellschaftliche Außenseitertum verwandelt sich zur Quelle der Kraft.
Psychologiekritik von Michel Foucault
Michel Foucault (1926 – 1984) war ein französischer Philosoph. In seiner Psychologie-Kritik zeigt sich vor allem die Verwobenheit von Wissen und Macht. Er zeigt, dass psychologische und psychiatrische Diskurse nicht neutral sind, sondern Teil eines gesellschaftlichen Kontrollapparates, der Abweichung definiert und normiert. „Wahnsinn“ erscheint bei ihm nicht primär als medizinischer Tatbestand, sondern als historisch erzeugte Kategorie, die Menschen ausschließt und diszipliniert. Diese Dekonstruktion rüttelt an der Legitimation einer Disziplin, die sich als objektiv und heilend präsentiert, zugleich jedoch subtil Hierarchien reproduziert. Sein Ansatz ist grundlegend, weil er zeigt, wie „Wahrheiten“ über die Psyche stets kontextgebunden, historisch wandelbar und politisch funktional sind.
Die Schule dient denselben sozialen Funktionen wie Gefängnisse und psychiatrische Einrichtungen – um Menschen zu definieren, zu klassifizieren, zu kontrollieren und zu regulieren. – Michel Foucault, Der Wille zum Wissen
Die Negativ-Phänomen in der Psychose
Die Negativ-Aspekte während einer Psychose – respektive Bewusstseinsverschiebung – sind für die betreffende Person belastend. So sehr die Methoden der Psychologie und die Methoden der Psychiatrie zu kritisieren sind, so wertvoll ist es jedoch, dass es Hilfe gibt. Das Entsetzen, das Vera Maria erlebt hat, ist leidvoll. Zu verhindern ist, dass ein Mensch mit Paranoia mit dem Messer auf andere losgeht, weil er sich von ihnen bedroht fühlt. Auch darf es nicht sein, dass ein Mensch in der Psychose die Katze aus dem Fenster wirft, weil er denkt, sie wäre der Teufel. Da ist m. E. eine Grenze erreicht und überschritten und selbstverständlich sollte hier eingegriffen werden.
Die Pathologisierung übersinnlicher Erfahrung
Dass aber auch Bewusstseinsverschiebungen, die keine Selbst- oder Fremdgefährdung mit sich bringen, generell pathologisiert werden, mit oder ohne Positiv-Aspekte, lässt tief in Wissenschaftsgläubigkeit blicken.
Aus psychiatrischer Sicht ist jedwede spirituelle Komponente – bzw. gewöhnlich erlebte Spiritualität, auch wenn sie keinen Leidensdruck erzeugt – pathologisch: Mediale Kundgaben, das Stimmen-Hören, die außerkörperliche Erfahrung, das Sehen der Aura oder das Sehen von Energielinien, energetische Empfindungen, Kontakt zu Verstorbenen usw. All das ist aus psychiatrischer Sicht behandlungswürdig. Auch ein Kundalini-Erwachen wird bei Unkenntnis des Erwachenden, der psychologische Hilfe in Anspruch nehmen möchte, i. d. R. als Psychose gewertet.
Spiritualität ist tausende Jahre alt. Psychologie ist wenige hundert Jahre alt.
Zwischen Psychose, Psychosomatik und Spiritualität
Ähnlich wie ich sieht es Kurt Gemsener, Facharzt für Psychosomatische Medizin, der seinem Bericht zufolge in einen ähnlichen Konflikt gekommen ist. Er ist bestrebt, Psychose anders zu betrachten.
Er entwickelte ein Modell, das Psychose nicht ausschließlich als Krankheit, sondern als Ausdruck eines kritisch veränderten Bewusstseins versteht. Dieses Bewusstsein bewegt sich auf derselben Tiefenebene wie transpersonale Erfahrungen, die in Selbsterforschung und Therapie zugänglich werden.
Er unterscheidet zwischen zwei Haltungen:
-
- Psychiatrie: Ziel ist die Kontrolle und Unterdrückung von Symptomen durch Medikamente.
- Gestalttherapie: Ziel ist die Vertiefung des Erlebens, das Vertrauen in spontane Prozesse und die Begleitung individueller Entwicklungen – auch wenn dies vorübergehende Krisen verstärkt.
Psychotische Zustände werden damit als Übergangszustände zwischen Integration und Desintegration gesehen. Sie gehören zu einem Bewusstseinskontinuum, das sowohl destruktiv verlaufen als auch kreative, spirituelle oder transpersonale Dimensionen öffnen kann – wie etwa bei den medialen Erfahrungen von Jane Roberts.
Die These: Psychose kann als kritisches Tor zu tieferen Bewusstseinsschichten verstanden werden – pathologisch, wenn unverarbeitet, transformativ, wenn integriert.
Quelle: Zwischen Psychose, Psychosomatik und Spiritualität.
Essenz der Analyse
Psychose ist nicht der Endpunkt einer Fehlfunktion, sondern der Beginn einer Initiation. Das, was als Wahnsinn abgetan wird, fängt meiner Ansicht nach eine hypersensible Frequenz des Kosmos ein, eine spirituelle Erweckung, die das kognitive Gefüge sprengt.
Teile den Beitrag
Wenn du der Meinung bist, dass dieser Text auch andere inspirieren kann, dann teile ihn in Social Media. Teilen-Buttons untenstehend.
Hat dir der Artikel gefallen? Dann abonniere den Blog. Siehe „Artikel per Mail“, rechte Seitenleiste, oder klick hier, und erfahre, welche Vorteile dir das Abo bringt.